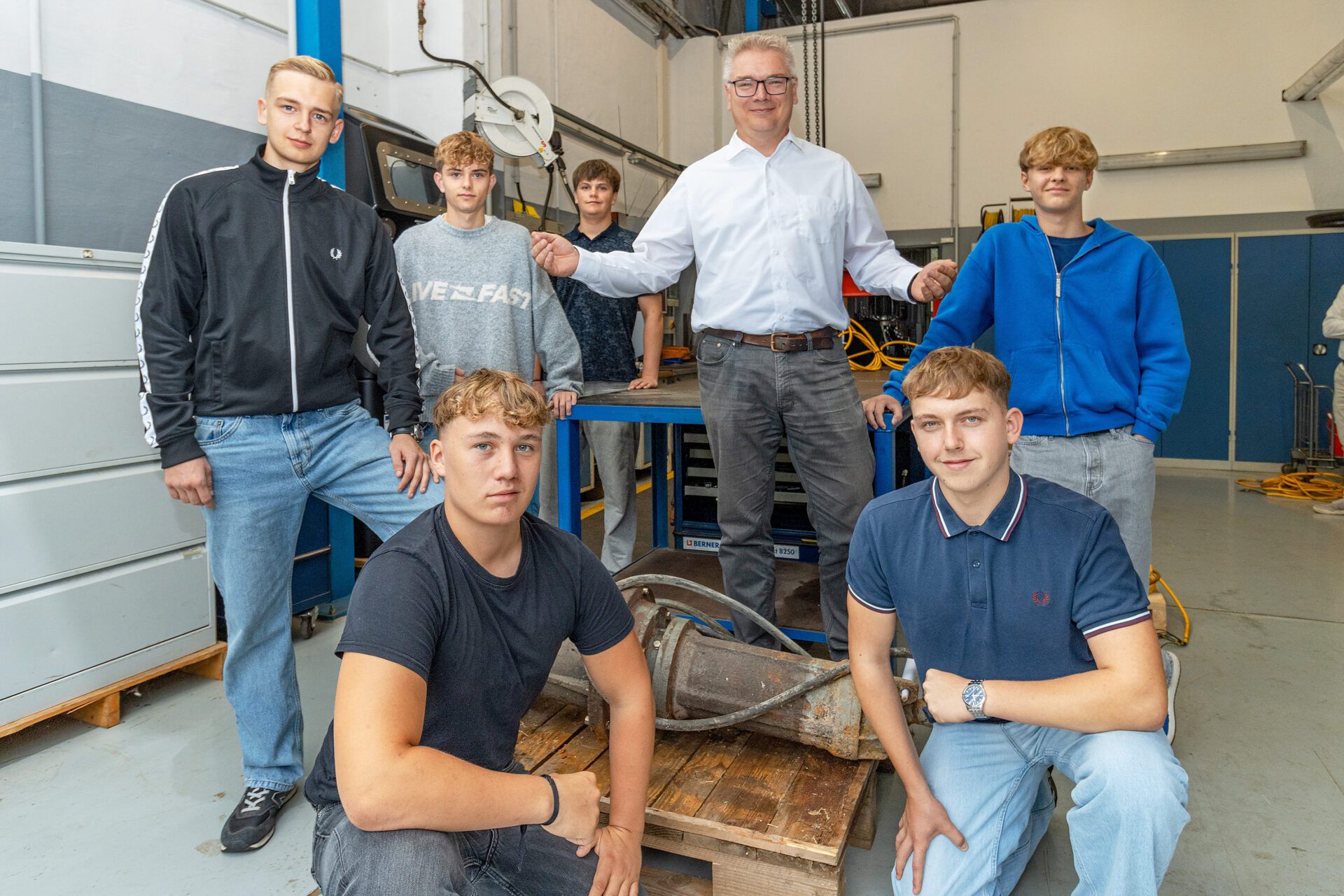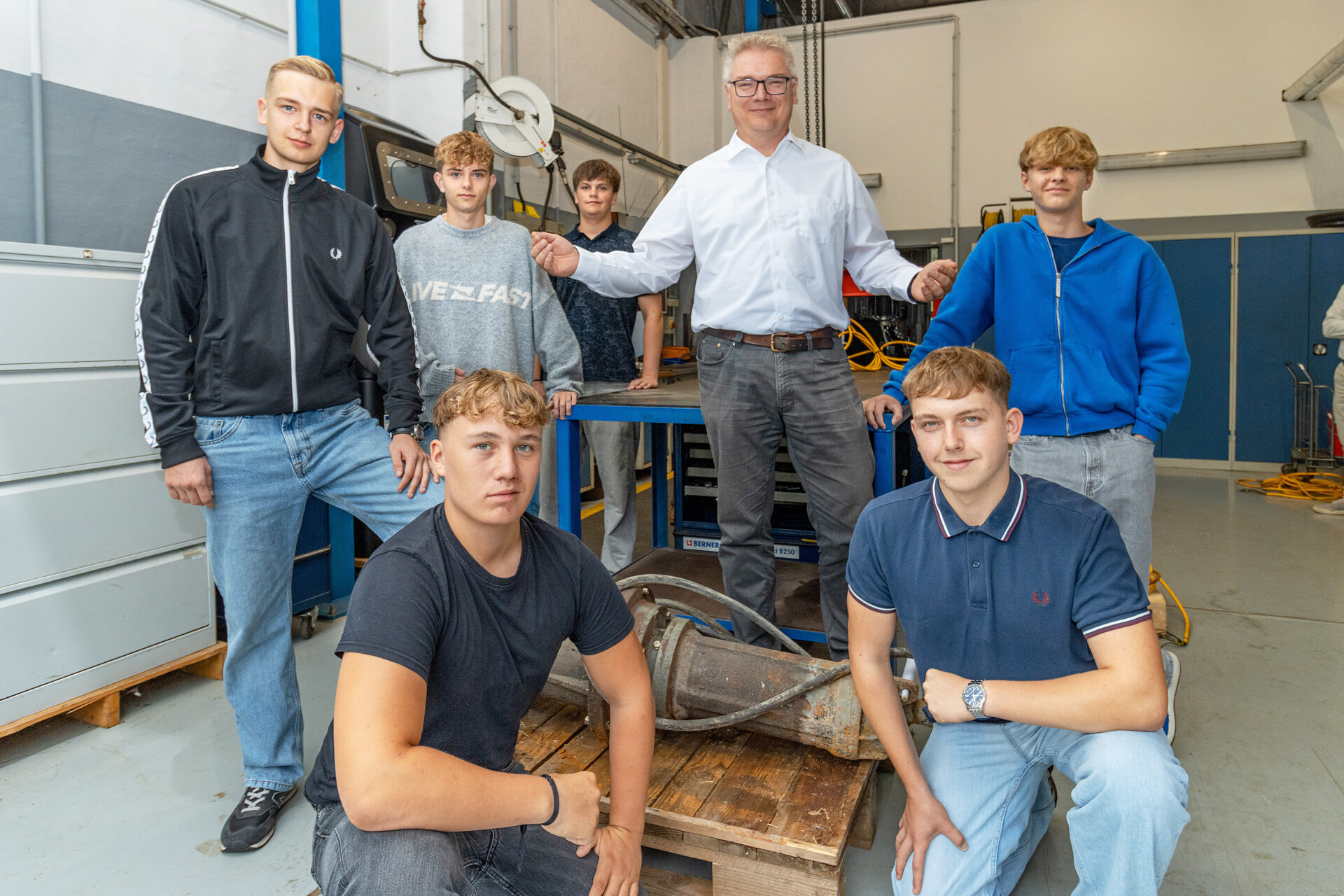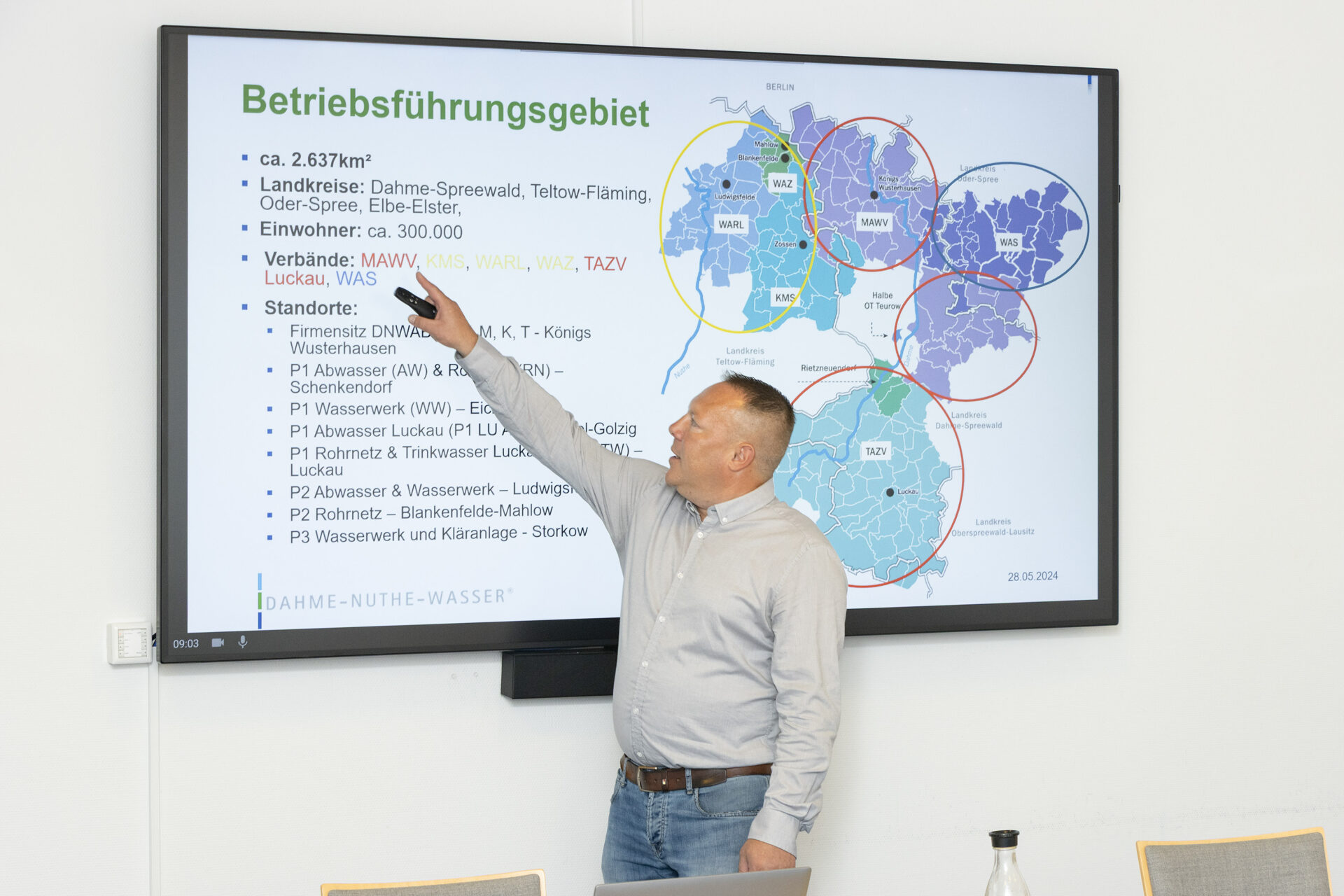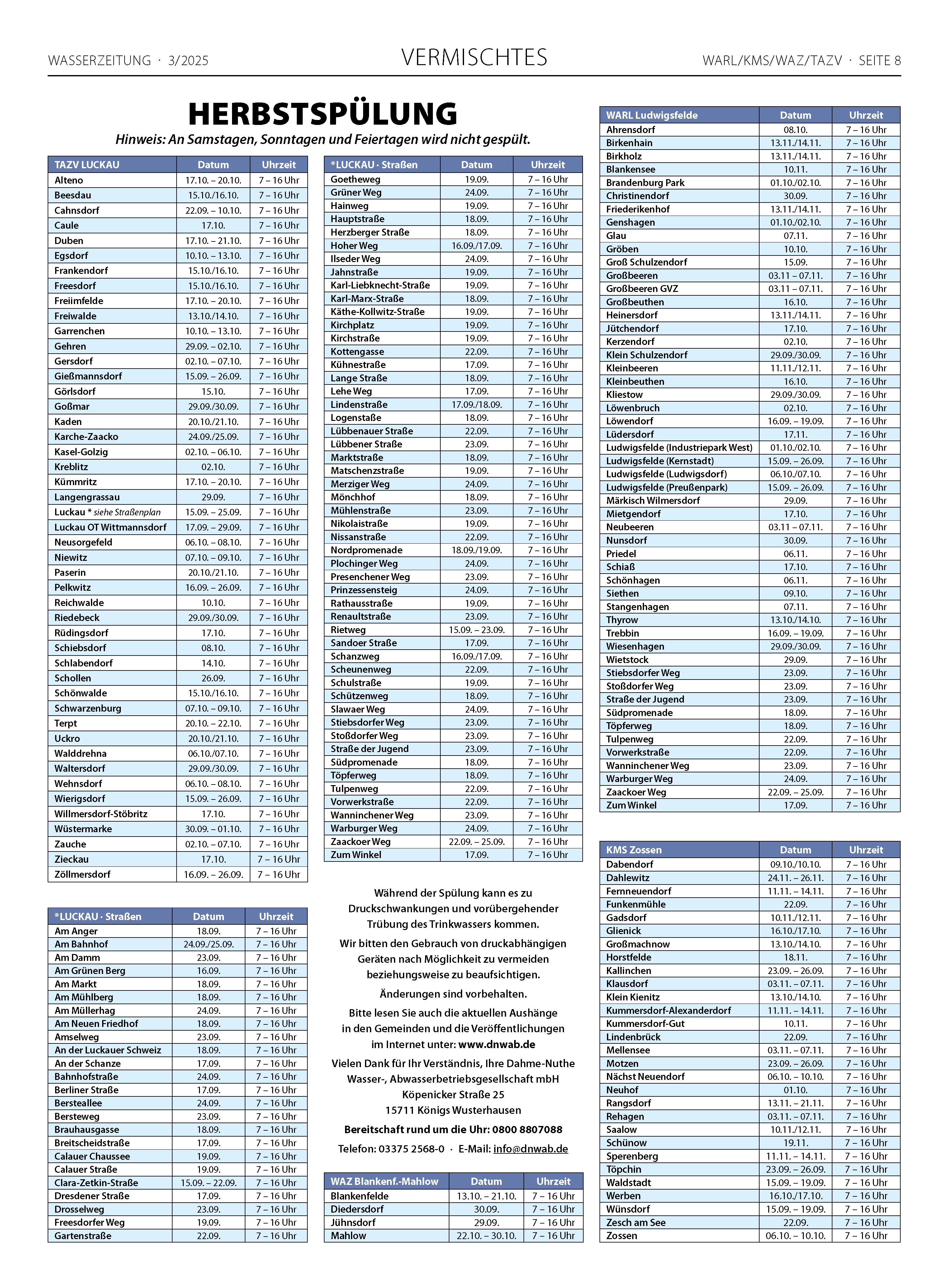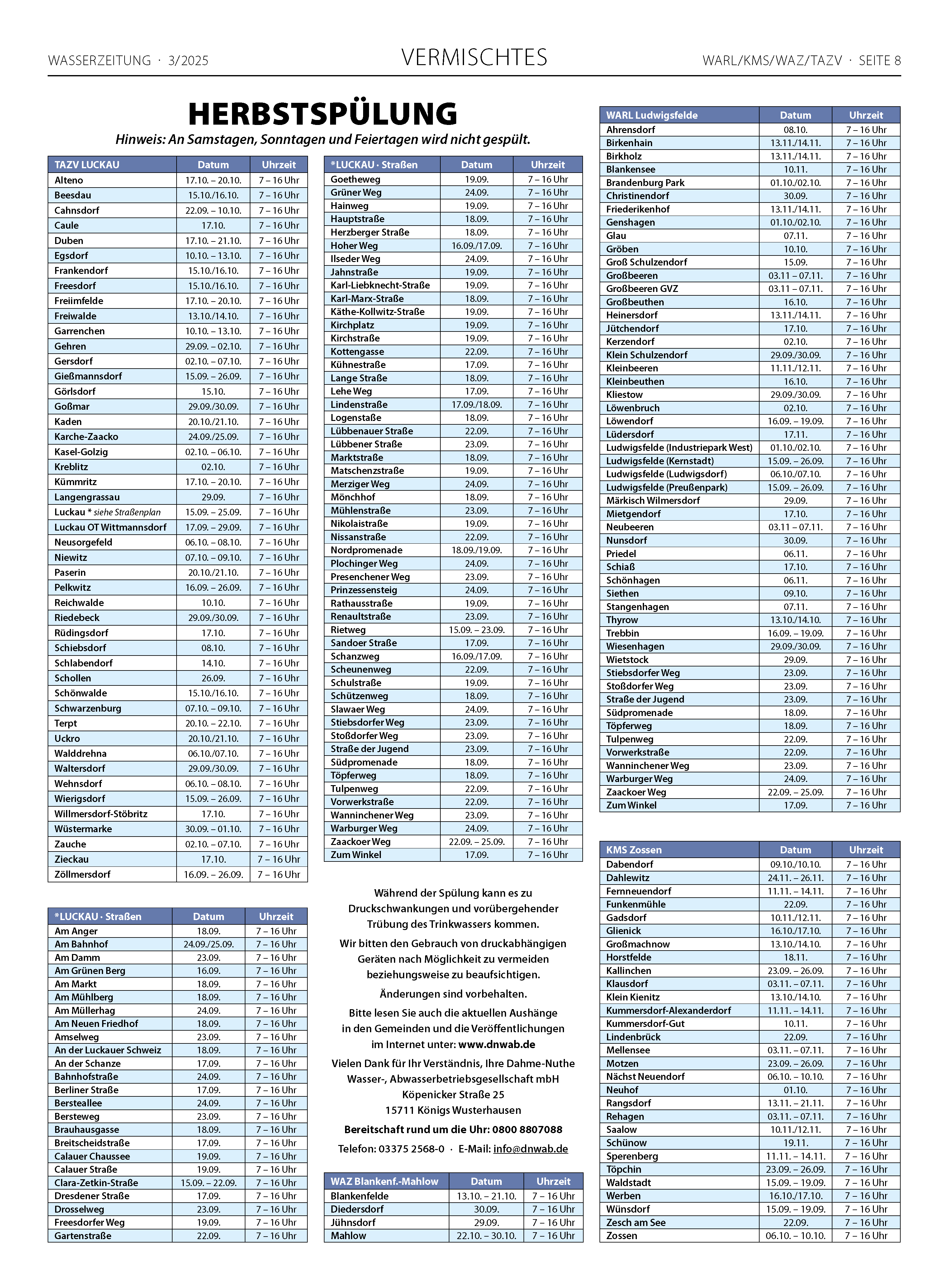Immer im Sinne der Anlagen
Immer im Sinne der Anlagen
Wetter – egal welches – ist für Ihren Ver- und Entsorger WAZ Blankenfelde-Mahlow kein Problem. Schließlich könne man das eh nicht beeinflussen und müsse sich mit Mensch und Technik jeder Witterungs-Herausforderung stellen, so die Begründung.
Mal Regen und mal Sonnenschein – der Sommer 2025 strapazierte die Wetter-Nerven bei uns Menschen. Nicht bei den Zweckverbänden. Für sie gehört „Wetter“ zum Arbeitsalltag.
Fotos (2): SPREE-PR/Petsch
„Es ist ja unsere Aufgabe, Wasserversorgung und Abwasserableitung das gesamte Jahr über zu sichern“, meint Antje Motz. Das schließe heiße Sommer, Dürren und Starkregen ein. Die Verbandsvorsteherin aus Blankenfelde-Mahlow betont aber auch: „Der Wasserbedarf ist besonders in heißen Sommern konstant hoch. Da werden Pools befüllt, Rasen, Bäume und Pflanzen gegossen, man duscht häufiger. Das hat Auswirkungen auf unsere Anlagen. Je häufiger sie stark ausgelastet sind, desto schneller verschleißen sie und müssen erneuert werden. Was wiederum Auswirkungen auf die Preise und Gebühren hat.“
„Mitgefühl“ mit der Technik
Auf diese Ausnahmesituationen müssen die Fachleute bei den Verbänden und ihrer Betriebsführerin DNWAB vorbereitet sein. „Das sind wir auch“, betont Antje Motz. „Wenngleich das wechselhafte Wettergeschehen in den Sommermonaten 2025 hohe Anforderungen an unsere Branche gestellt hat.“ Begründung: „Während Hitze und Trockenheit die Trinkwasserabnahmemengen stark erhöhen, belasten Starkniederschläge die Abwasserkanäle, Pumpwerke und Kläranlagen. Zur Entlastung der Systeme könne jeder beitragen“, sagt sie. Beispielsweise, indem bei Hitze in Spitzenlastzeiten vor allem auf Bewässerung und Poolbefüllung verzichtet wird und bei Starkregen Fehleinleitungen von Regenwasser über die Grundstücksentwässerungsanlagen vermieden werden.
Mitdenken für die Anlagen
Antje Motz sieht hier nicht nur die kommunalen Versorger in der Pflicht: „Wasser ist eine endliche Ressource. Der bewusste Umgang mit unserem Lebensmittel Nr. 1 fängt bei jedem zu Hause an.“ Wenn in Trockenperioden ganz selbstverständlich Blumen, Nutzpflanzen, Rasen & Co. nur außerhalb der Spitzenzeiten Wasser bekämen und nicht mehr dazu aufgerufen werden müsse, dann sei bereits einiges geschafft – beim Umdenken im Sinne der Anlagen.
Mit passenden Maßnahmen
In Wasserwerken und an der Leitungsinfrastruktur wird vorbeugend viel getan, damit bei allen Witterungsszenarien die Ver- und Entsorgungssicherheit garantiert werden kann.
- So hat der WAZ – und tut es immer noch – in leistungsstarke, weniger anfällige und energiesparende Pumpen investiert.
- Regelmäßige Inspektionen und Wartungen sämtlicher Anlagen verhindern deren Ausfall bei außergewöhnlichem Wettergeschehen.
- Viele Pumpwerke sind ins Prozessleitsystem eingebunden, alle mittleren und großen Pumpwerke haben Frequenzumrichter, die automatisch auf große Wassermassen reagieren.
- Mit hochmoderner Technologie werden im Rohrnetz Leckagen aufgespürt, die insbesondere bei Sommerspitzen zu Druckabfall oder gar längeren Versorgungsausfällen wegen Reparaturen führen könnten.