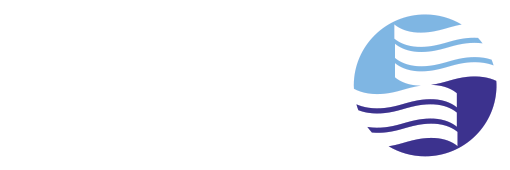Danke für Ihr Engagement!
Diese Drei wissen, wofür sie kämpfen
Die Abwasserzweckverbände in Sachsen-Anhalt sorgen dafür, dass Abwasser gereinigt den Fließgewässern wieder zugeführt wird. Das ist aktiver Umweltschutz. Neben den Profis gibt es überall Menschen, die sich privat oder in Vereinen engagieren und Arbeitskraft, Wissen und kostbare Zeit mit Herzblut in den Schutz der Gewässer stecken. Ohne sie würde es nicht gehen. Wir möchten drei dieser Menschen vorstellen und ihnen herzlich danken!
Heimo Reilein, 55 Jahre alt, ist der Vorsitzende der IG-Bode-Lachs e.V.

Heimo Reilein schaut Politik und Wirtschaft in Sachen Gewässerschutz genau auf die Finger und kämpft für gesunde Gewässer.
Foto: privat
Der Verein beschäftigt sich unter anderem mit gesetzlichen Vorgaben des Gewässerschutzes und kämpft dort, wo dieser augenscheinlich nicht eingehalten wird. Etwa bei Bauvorhaben oder beim Rückbau von Wehren. Der Linienbus-Fahrer aus dem Harzkreis veranstaltet mit seinen Mitstreitern unter anderem Fachtagungen, steht Anglervereinen zur Seite und fährt zu Fortbildungen. Seine Motivation: Es habe noch nie so strenge Gesetze zum Schutz der Umwelt gegeben und dennoch werde es immer schlimmer.
Herr Reilein, wann hat Ihre Leidenschaft für Gewässerschutz begonnen?
Heimo Reilein: Seit ich laufen konnte, hatte ich eine Angel in der Hand. Ich bin sozusagen familiär vorbelastet. Mein Vater, mein Großvater – jeder in der Familie war Angler. Ich hatte somit einen Bezug zu Fischen und damit zu den Gewässern. Ich habe gesehen, dass viele Gesetzgebungen nicht eingehalten werden, was die Gewässer verschlechtert. Irgendwann hatten meine Mitstreiter und ich die Schnauze voll. Alle reden vom Artensterben, Verlust von Lebensräumen und dennoch, anstatt Flüsse zu renaturieren, werden Gifte eingeleitet oder Wasserkraftanlagen gebaut.
Was gibt Ihnen bei Ihrer Arbeit Kraft?
Wenn unsere Darlegungen bei einem Bauvorhaben zu Verbesserungen führen, ohne dass unser Anwalt aktiv werden muss, ist das bereits ein großer Erfolg. Oder wenn Außenstehende bei Tagungen sagen, dass sie etwas gelernt haben, dass ihnen so gar nicht bewusst war. Oder wenn ich eine wunderschöne Natur-Forelle fange, der ich ansehe, was ich da für ein hochwertiges Lebensmittel in der Hand halte, weil das Gewässer intakt ist. Dann weiß ich, wofür ich täglich kämpfe.
Was wünschen Sie sich von Ihren Mitmenschen?
Die breite Öffentlichkeit sollte sich vertieft mit der Bedeutung von Flüssen beschäftigen. Sie haben eine solch essentielle Wichtigkeit für uns alle. Das ist unbequem. Fische sind sensible Indikatoren für den Gewässerzustand. Die Angelfischerei ist nicht das Problem, sondern kann dazu dienen, negative Entwicklungen schnell zu erkennen. Mein großer Appell ist: Informiert euch und fragt!
Hagen Hepach ist 58 Jahre alt und bewirtschaftet die vier Teiche in Walbeck in der Nähe von Hettstedt.

Hagen Hepach füttert lediglich bei seinen Fischen, die er für seine Räucherei fängt, etwas zu. Den Rest überlässt er der Natur.
Foto: privat
Der erste wurde vor über eintausend Jahren neben dem Kloster angelegt, um in der Fastenzeit an Fisch zu kommen. Der jüngste kam in den 1950ern dazu. Hepach kümmert sich um die Gesundheit der Teiche, die über einen kleinen Bach, die Wipper, die Saale und die Elbe mit den Weltmeeren im Wasserkreislauf verbunden sind. Der ehemalige Dachdecker füttert bei den Fischen etwas zu und betreibt eine Fischräucherei. Sein Motto: Möglichst wenig eingreifen und die Natur machen lassen.
Herr Hepach, wie sind Sie zum Wasser gekommen?
Hagen Hepach: Ich hatte immer eine große Liebe zum Wasser, sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Ich habe sie durch gefährliche Aktionen viele Nerven gekostet. 1988 bin ich nach Walbeck gezogen und habe über den Angelverband die Teiche kennengelernt. Als ich meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, kannte ich bereits die Leute, die die Teiche gekauft hatten und habe gefragt, ob ich sie pachten könnte. Heute bin ich Eigentümer.
Wie engagieren Sie sich für den Wasserschutz?
Ich habe anfangs versucht, die Teiche touristisch attraktiv zu machen. Mit meiner Fischräucherei für Angler und Spaziergänger. Inzwischen habe ich die Teiche eingezäunt. Es muss nicht jeder zu allem Zutritt haben. Ich versuche so viel wie möglich der Natur zu überlassen. Im Herbst machen wir eine Woche lang Biounterricht vor Ort mit allen siebten Klassen der Sekundarschule „Anne Frank“.
Was würden Sie sich von Ihren Mitmenschen wünschen?
Dass sie achtsamer mit Wasser umgehen. Es tut gar nicht weh, wenn man etwas mitdenkt, was man ins Abwasser kippt, bei Düngemitteln aufpasst oder Produkte ohne Mikroplastik benutzt. Wir bestehen zum Großteil aus Wasser und würden doch gerne aus sauberem Wasser bestehen.
Wolfgang Weise, ehemaliger Ortsbürgermeister der Ortschaft Kötzschau bei Bad Dürrenberg.

Wolfgang Weise setzt seine Hoffnung beim Gewässerschutz auf die nächste Generation und bringt Drittklässlern den Elsterfloßgraben und seine Bedeutung näher.
Foto: SPREE-PR/Schlager
Wolfgang Weise arbeitet seit Jahren eng mit dem Förderverein Elsterfloßgraben e.V. zusammen, obwohl er selbst kein Mitglied ist. So hat sich der 74-Jährige dafür eingesetzt, dass die Stadt Leuna Mitglied des Fördervereins geworden ist. Auch veranstaltet er jedes Jahr mit dem ZWA Bad Dürrenberg mit Drittklässlern am „Tag des Wassers“ ein Schauflößen.
Herr Weise, was bewegt Sie dazu, sich für den Elsterfloßgraben zu engagieren?
Wolfgang Weise: Mir tut es persönlich weh, wenn ich sehe, wie die Elsterfloßgrabenaue stirbt, wenn nach Trockenheit im Graben kein Wasser mehr fließt. Ich bin hier aufgewachsen und die schönsten Kindheitserinnerungen sind Picknicke an dieser Aue, als noch Wasser da war. Ich möchte, dass erhalten bleibt, was noch vorhanden ist.
Was ist für Sie von größter Bedeutung in Ihrem Engagement?
Ich möchte etwas für die nächste Generation tun. Das Wasser des Grabens geht über einen Bach in ein Staubecken, das von der Landwirtschaft genutzt wird, um vertrocknete Ernten zu verhindern. Wenn die Kinder das lernen, erkennen sie, wie wichtig der Elsterfloßgraben ist. Wir erzählen ihnen von der Bedeutung in der Vergangenheit und dass die Ausschachtung des Grabens von Zeitz bis hierher durch Menschenhand entstanden ist. Es gab noch keine Maschinen. Das ist beeindruckend und spannend für die Kinder. Sie reden dann mit ihren Eltern darüber und wollen mit ihnen dorthin.
Was würden Sie sich von Ihren Mitmenschen wünschen?
Es herrscht in der Bevölkerung eine gewisse Gleichgültigkeit, die ich beseitigen möchte. Vieles wird resigniert hingenommen. Der Förderverein steht oft alleine da. Dabei müsste so viel angepackt werden und die Mittel fehlen. Ich habe das Gefühl, dass über die Kinder die Wichtigkeit des Wassers angenommen wird. Ich habe oft Anfragen von Elterngruppen für begleitete Rundgänge am Graben. Die Gefahr ist riesengroß, dass der Graben austrocknet. Besonders, wenn das Wasser aus dem Tagebau irgendwann wegbleibt.
Zurück zur Startseite