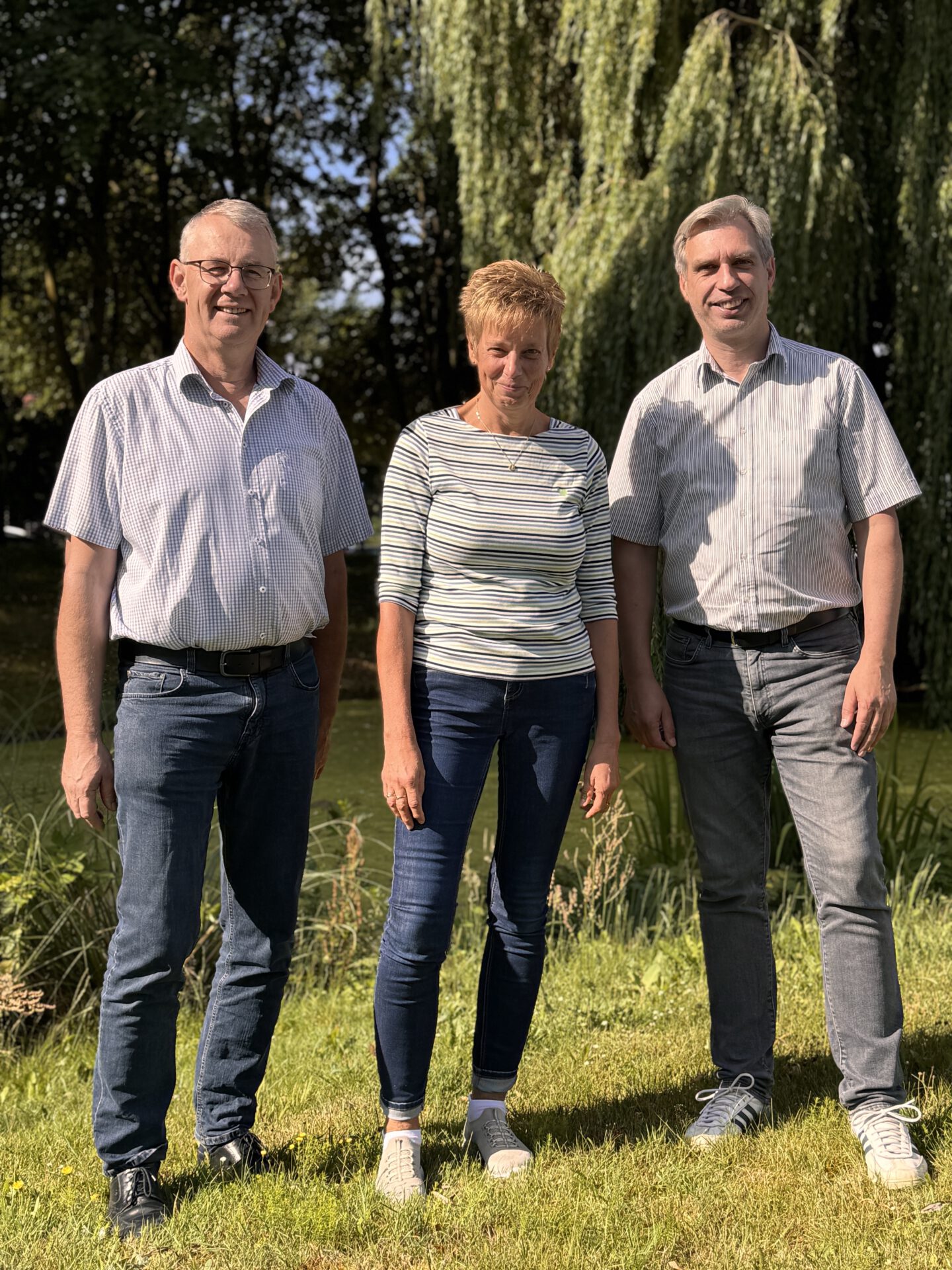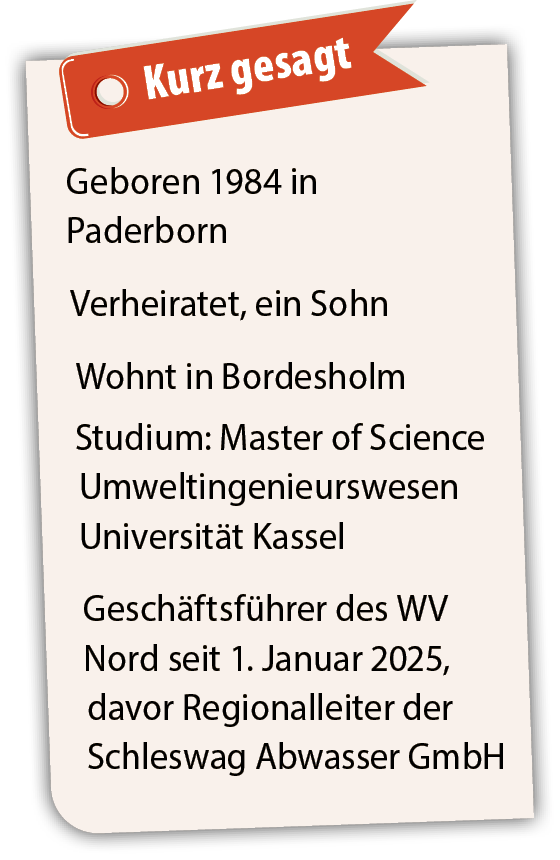4 Verbände, 4 Projekte – das haben wir 2025 gemeistert
Wasserwirtschaft aktuell
4 Verbände, 4 Projekte – das haben wir 2025 gemeistert
In Zeiten, in denen vieles teurer wird, die Weltwirtschaft sich immer wieder neu sortieren muss, es bürokratische Hürden oder Lieferengpässe zu überwinden gilt, ist es nicht immer leicht, Vorhaben umzusetzen. Mit Stolz können die vier Herausgeber der Ostthüringischen WASSERZEITUNG auf gelungene Projekte in 2025 zurückblicken.

Foto: ZWA Saalfeld-Rudolstadt
Bau eines Regenüberlaufbeckens in Saalfeld, Am Weidig
ZWA Saalfeld-Rudolstadt
Optimaler Schutz bei Starkregen: Um überschüssiges Schmutz- und Regenwasser zurückzuhalten und damit die Kläranlage zu entlasten, wurde in Saalfeld vom „Meininger Hof“ bis zum „Weidig“ ein Hauptsammler verlegt, der künftig Abwässer aus dem oberen Stadtgebiet in ein neues Regenüberlaufbecken (RÜB) leitet. Ein Zwischenspeicher sozusagen. Das Schmutzwasser wird damit kontrolliert in die Kläranlage Saalfeld geleitet und gereinigt.
Das steht 2026 an: „Ein großes Projekt wird die Gemeinschaftsbaumaßnahme in der Lengefeldstraße in Rudolstadt sein. Über 2 Mio. € werden für Trinkwasserleitungen und für den Kanalbau investiert“, sagt Andreas Stausberg.
„Das RÜB schützt unsere Gewässer vor ungereinigtem Schmutz- und Abwasser. Der Bau des Beckens läuft seit Juli 2025, das Investitionsvolumen beträgt rund 3 Mio. €“
Erneuerung einer Druckerhöhungsanlage in Eigenleistung
Zweckverband Wasser/Abwasser „Obere Saale“
Aus alt mach besser: In Sparnberg, einem Ortsteil der Stadt Hirschberg, wird ein ungenutztes Pumpwerk zu einer Druckerhöhungsstation umgebaut. Der Vorteil: Die Versorgungssituation für die angeschlossenen Anwohner wird verbessert und die Wasserdruckprobleme der oberen Lagen können behoben werden. Die komplette Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik wird erneuert und energieeffiziente Pumpentechnik eingebaut.
Das steht 2026 an: „Unsere alte Kammerfilterpresse hat uns 30 Jahre treue Dienste geleistet, im Jahr 2026 ist aber Zeit für eine Erneuerung“, so Ralf Engelmann.

Foto: ZWOS/Käckenmeister
„In Zeiten von Fachkräftemangel zeigt sich, dass es wichtig ist, die Fachkräfte im eigenen Haus zu haben.“

Foto: ZVME
Reinigung des Nitrifikationsbeckens auf der Kläranlage Gera
Zweckverband Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“
Putzkolonne für mehr Sauerstoff: Da sich die Reinigungsleistung verschlechtert hatte, musste es aufwendig gereinigt werden. Dazu wurde das Becken geleert, der Schlamm sowie alle Sandrückstände entfernt. Danach wurden die Belüfter ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Einfach hatten es die ZVME‘ler nicht: In Vollschutz ging es in das fünf Meter tiefe Becken mit rutschigem Boden.
Das steht 2026 an: „Die Reinigung der Nitrifikationsbecken wird 2026 fortgesetzt. Perspektivisch sollen alle vier Becken, die zur Kläranlage Gera gehören, eine Frischzellenkur erfahren“, so Gerd Hauschild.
„Die Nitrifikationsbecken spielen bei der biologischen Abwasserreinigung eine entscheidende Rolle. Hier wandeln Mikroorganismen das im Abwasser enthaltene Ammonium in Nitrat um. Nach der gründlichen Reinigung der Becken ist nun der Sauerstoffeintrag und damit die Reinigungsleistung wieder optimal.“

Fotos (2): ZWA/Felix Hertling
„In Kläranlagen steckt komplexe Technik im Millionenwert. Diese muss erhalten werden.“
Reinigungsaktion auf der Kläranlage Hermsdorf
ZWA „Thüringer Holzland”
Bloß kein Stillstand: Bei der Reinigung des Faulturms im Herbst 2025 wurde die Schlammdecke mit einer Hochdruckdüse mit über 1.000 bar zersetzt und durch ein leistungsstarkes Saugfahrzeug entfernt. Das Material wurde in Absetzcontainern entwässert und anschließend entsorgt. Die Maßnahme trägt zur optimalen Funktion und Langlebigkeit der Anlage bei. Auf den beiden Fotos sind die Öffnung des Faulturms per Kran und die Schlammoberfläche nach der Reinigung zu sehen.
Das steht 2026 an: „Im kommenden Jahr stehen 28 Einzelmaßnahmen im Wert von etwa 14 Mio. Euro an. Eine wichtige geförderte Maßnahme ist der Beginn der Entwässerung Bibra im Reinstädter Grund als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Saale-Holzland-Kreis, sagt Steffen Rothe.

Wasser bewegt – Projekte 2025
2025 war für uns ein bewegtes Jahr.
-

Gerd Hauschild
Geschäftsleiter des ZV Mittleres Elstertal
-

Steffen Rothe
Werkleiter des ZWA „Thüringer Holzland“
-

Andreas Stausberg
Geschäftsleiter des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
-

Ralf Engelmann
Geschäftsleiter des ZWA, „Obere Saale“
Fotos (4): SPREE-PR/Archiv