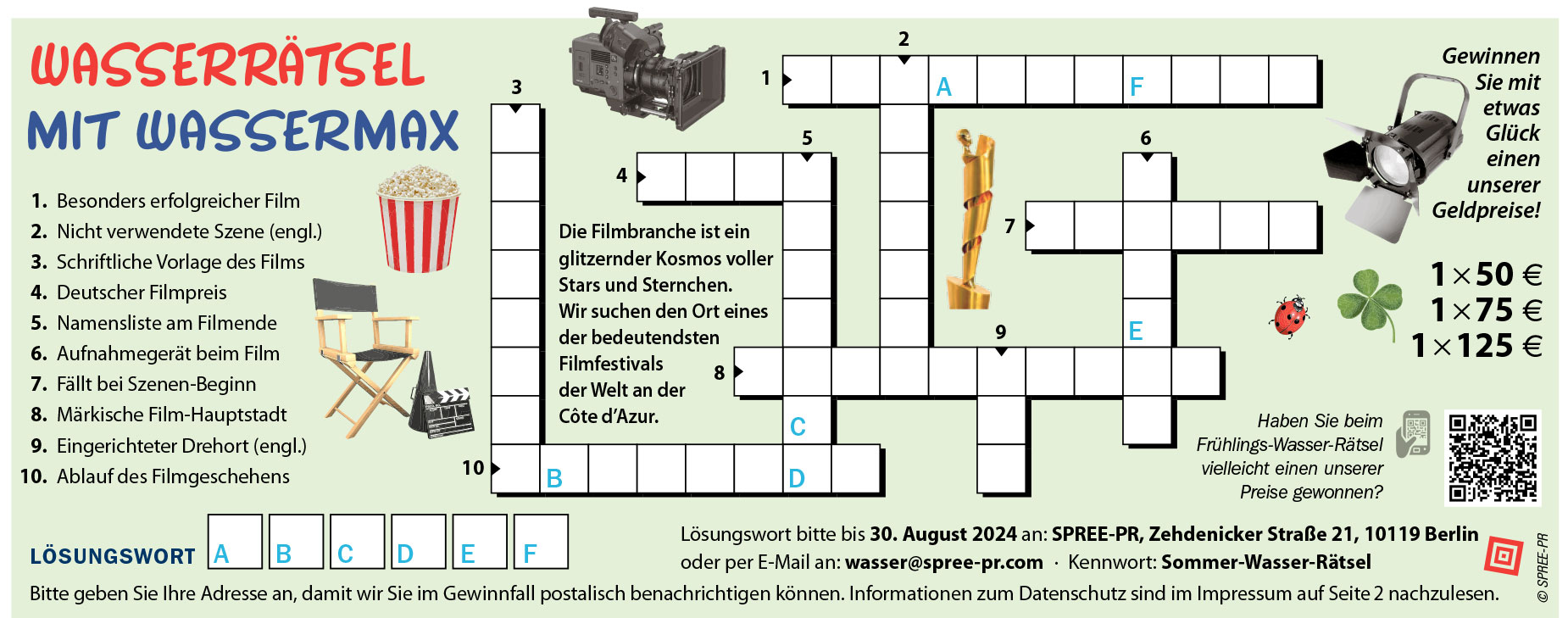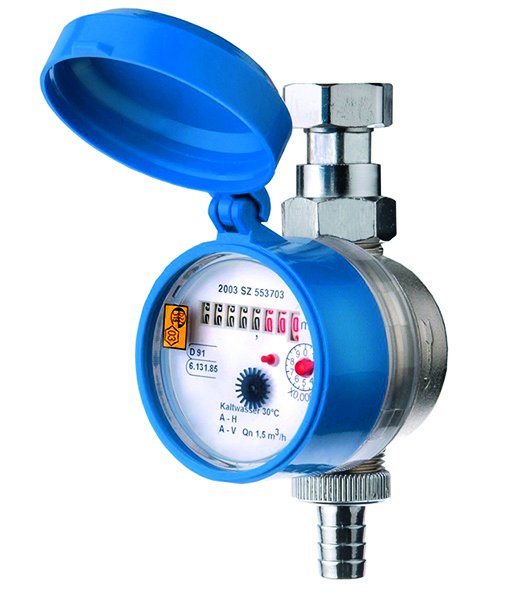6 Stunden Weg pro Tropfen Wasser
In die Ruhlander Heide, südwestlich von Senftenberg gelegen, brechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gerne auf. Am Wochenende gerne zum Spazierengehen, aber eben auch an Werktagen. Dann wollen sie in der Regel nach Tettau, wo unser wichtigstes Wasserwerk steht – das größte seiner Art in ganz Brandenburg. Es ist schlicht das Herz der Trinkwasserversorgung für weite Teile Südbrandenburgs. Wie dieses „am Schlagen“ gehalten wird, erfuhren Schülerinnen und Schüler am diesjährigen Weltwassertag (22. März).
Warum muss man Wasser belüften? Warum riecht es im Wasserwerk nach faulen Eiern? – Fragen über Fragen prasselten auf Verbandsvorsteher Christoph Maschek und seinen Technischen Controller Lutz Augstein ein, die alle geduldig beantwortet wurden. Das versteht sich doch von selbst! Genau darüber Bescheid zu wissen, wie das Grundwasser aus den Tiefen (ca. 30 m) des Lausitzer Urstromtals seinen Weg zu den heimischen Hähnen findet, sollte allen Kids bewusst sein. Sage und schreibe bis zu 440.000 Badewannen könnten die Brunnen an die Erdoberfläche befördern – pro Tag! Und vom „Betreten“ des Wasserwerkes bis zum „Lagern“ in der Reinwasserkammer durchläuft jeder kostbare Wassertropfen rund sechs Stunden lang das Aufbereitungsprozedere zum hochwertigsten Lebensmittel für uns alle. Danke für Euren Besuch, und bis zum nächsten Mal!
Erst reinschnuppern, dann ausbilden lassen
Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Das gilt erst recht für den beruflichen Weg, den Schülerinnen und Schüler einschlagen wollen. Beste Gelegenheit, mögliche Ausbildungen kennenzulernen, bietet der „Zukunftstag“.
Martin Günther weiß genau, womit er bei den baldigen Schulabgängern punkten kann, die am Zukunftstag (25. April) zu den Wasserexperten nach Senftenberg gekommen sind. Der Leiter des Bereiches Abwasser-Netze bei WAL-Betrieb präsentiert den jungen Besucherinnen und Besuchern unter anderem ein modernes Spülfahrzeug. Auch das Auto fürs „Kanal-TV“ steht zufällig gerade für eine Besichtigung vor dem Verwaltungsgebäude am Stadthafen parat. Wie die kleine Maschine durch die unterirdischen Kanäle fährt und Schwachstellen aufdeckt, zeigt sich direkt auf dem Display. Ein Bildschirm! Vertraute Technik für die Teenager … die dann auch noch Azubis aus allen drei Unternehmensbereichen trafen und deren persönlichen Erfahrungen aus der Lehre lauschten. Das konnte punkten! Denn tatsächlich konnte die Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH weitere Jugendliche für eine Ausbildung begeistern. So wurde aus einem Schnuppertag vielleicht eine gute Entscheidung fürs Leben.
Ihr alle könnt dem Wasser helfen
„Was bedeutet es für den Wasserverband Lausitz (WAL) und seinen Betriebsführer WAL-Betrieb, generationengerecht zu arbeiten?“
Dieser Frage hat sich der Facharbeiternachwuchs von WAL-Betrieb angenommen: die Azubis Industriekauffrau/-mann Sabrina Berthold und Jonas Feichtinger.
Wenn wir über unser kostbares Gut, das Trinkwasser, sprechen, dann geht es für uns um drei wesentliche Punkte: Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit und Ressourcenschutz.
Fangen wir vorne an! Nachhaltigkeit bedeutet, dass Wasserversorger bei ihrer Arbeit jederzeit die Zukunft im Blick haben. Unsere Versorgungs- und Entsorgungssicherheit heute darf nicht im Geringsten auf Kosten zukünftiger Generation gehen. Es ist wichtig, dass alle über den aufwändigen Weg des Wassers Bescheid wissen und sorgsam mit unserem Lebensmittel Nr. 1 umgehen. Damit die Wasserqualität auf höchstem Niveau bleibt, beschäftigen wir uns auch damit, wie Wasserverschmutzung reduziert und Abwasser wiederverwendet werden kann.
Dass jeder Mensch jederzeit Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser haben muss, versteht sich von selbst. Und der Griff zum Hahn darf auch nicht von der Sorge überschattet sein, es überhaupt bezahlen zu können. Permanente Investitionen in effiziente Technologien – einschließlich der Nutzung von Sonnenenergie für die Stromversorgung der Anlagen – sorgen dafür, dass der Preis des Trinkwassers und die Abwasserbehandlung angemessen und bezahlbar bleiben. Das funktioniert nur mit modernen Anlagen und Prozessen in unserem Wasserwerk und auf den Kläranlagen. Und darauf könnt Ihr Euch verlassen.
Sprechen wir darüber, wie wir unsere Ressource schützen. Unser Wasser – insbesondere das, das in Zukunft aus unseren Hähnen fließen soll – muss vor jeder Form von Verschmutzung bewahrt bleiben.
Müllentsorgung in der Natur, erst recht in der Nähe von Gewässern, ist ein absolutes No-Go. In der Landwirtschaft kommt es darauf an, Düngung auf das Unvermeidbare zu reduzieren.
Generell muss das der Natur entnommene Wasser so optimal wie irgendwie möglich gebraucht werden, in der Agrarwirtschaft etwa durch entsprechende Bewässerungstechniken.
Lasst uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass der kostbare Schatz Wasser erhalten bleibt, ohne eine finanzielle Belastung zu werden. Sauberes Wasser für alle Generationen gewährleisten wir durch verantwortungsvollen Umgang mit unserer Ressource. Jede und jeder kann helfen!