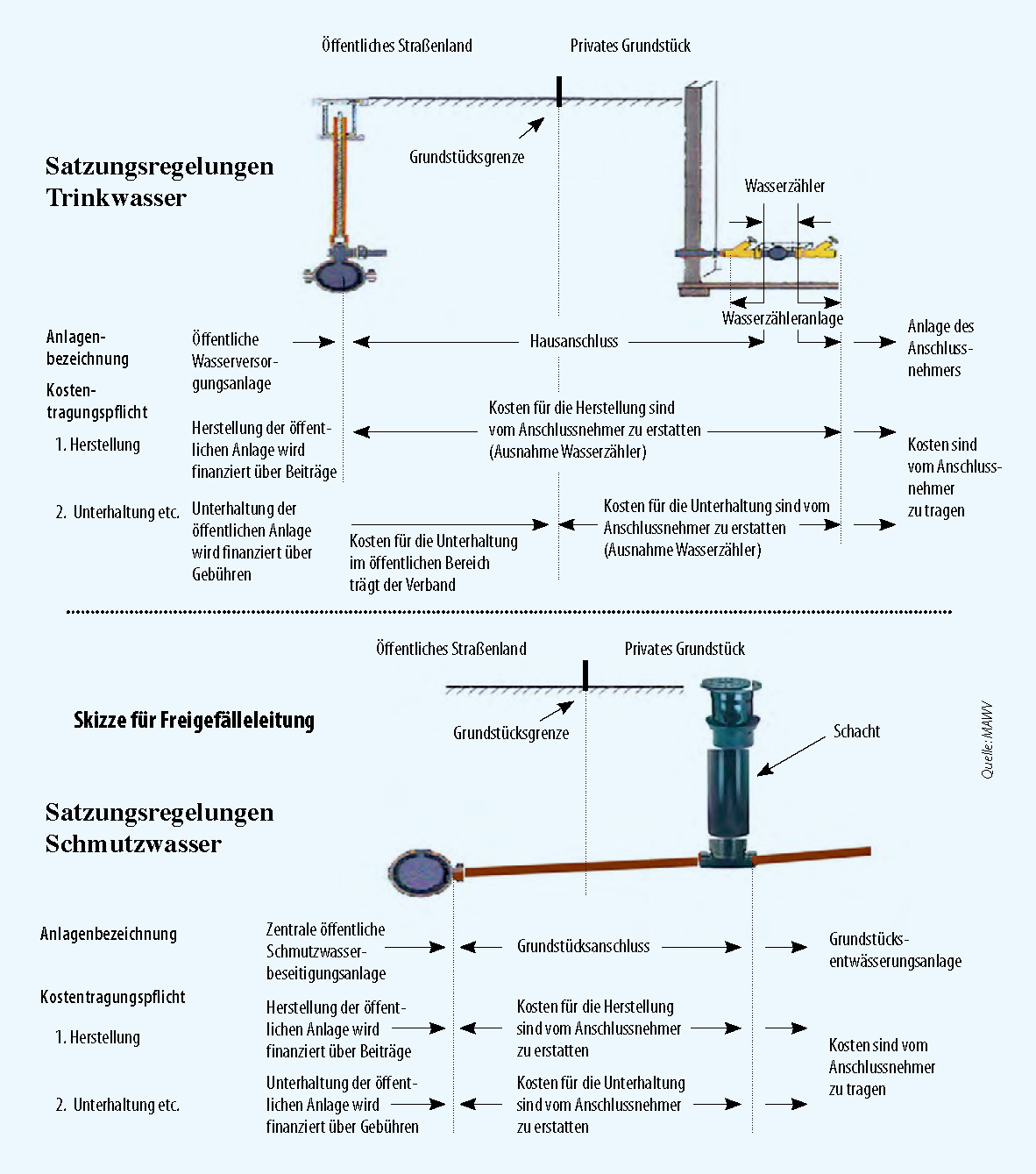Für die Kinder gab es dabei ein besonderes Highlight: Jede Schülerin und jeder Schüler erhielt eine hochwertige Trinkflasche des Partners @aboutwater.de – personalisiert mit der originalen Unterschrift des Bürgermeisters (kl. F.). Das ungewöhnliche Detail sorgt nicht nur für strahlende Gesichter, sondern unterstreicht auch die Wertschätzung für das Projekt und seine Botschaft. Der neue Wasserspender steht für bewussten Konsum, Ressourcenschutz und Gesundheit. Er soll die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, mehr Leitungswasser zu trinken – das nachhaltigste und am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Gleichzeitig stärkt die gemeinsame Nutzung der wiederbefüllbaren Flaschen den verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen und vermeidet Plastikmüll.
Mit dieser Initiative setzt die Gemeinde Schönefeld ein sichtbares und alltagstaugliches Zeichen für Umweltbewusstsein – und zeigt, wie moderne Bildungsarbeit, lokale Politik und Verbände Hand in Hand wirken können. Frisch, nachhaltig und gemeinsam eben.
Neues Angebot stärkt Gesundheit und Nachhaltigkeit
Bestensee hat seit dem 30. September einen Grund mehr zur Freude: An der örtlichen Grundschule wurde ein neuer Trinkwasserspender feierlich in Betrieb genommen – ein Projekt, das gleichermaßen für Begeisterung bei den Kindern und für ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit sorgt.
Gemeinsam mit dem Bürgermeister, der Verbandsvorsteherin des MAWV, der Schulleiterin und unter tatkräftiger Unterstützung von Felix aus der 4. Klasse wurde der Spender offiziell gestartet. Kaum sprudelte das erste Wasser, testeten die Schülerinnen und Schüler neugierig die neue Station – und die Begeisterung war unübersehbar.
Für die Kinder gab es zudem ein besonderes Geschenk: Jede Schülerin und jeder Schüler erhielt eine eigene Trinkflasche. Damit können sie künftig jederzeit frisches Leitungswasser zapfen – gesund, umweltfreundlich und ohne zusätzlichen Müll.
Der neue Wasserspender ist weit mehr als eine technische Neuerung im Schulalltag. Er unterstützt die Kinder dabei, ausreichend zu trinken, was sich positiv auf Konzentration und Wohlbefinden auswirkt. Zugleich setzt die Schule ein starkes Zeichen für verantwortungsvollen Ressourcenverbrauch und zeigt, wie moderne Bildung und gelebte Nachhaltigkeit zusammengehen können.
Ein herzlicher Dank gilt den Schulleitungen, den Gemeinden Bestensee und Schönefeld sowie allen Beteiligten, die das Projekt ermöglicht haben. Gemeinsam schaffen sie ein Umfeld, in dem Kinder gesund aufwachsen und früh lernen, wie wertvoll unser Trinkwasser ist.