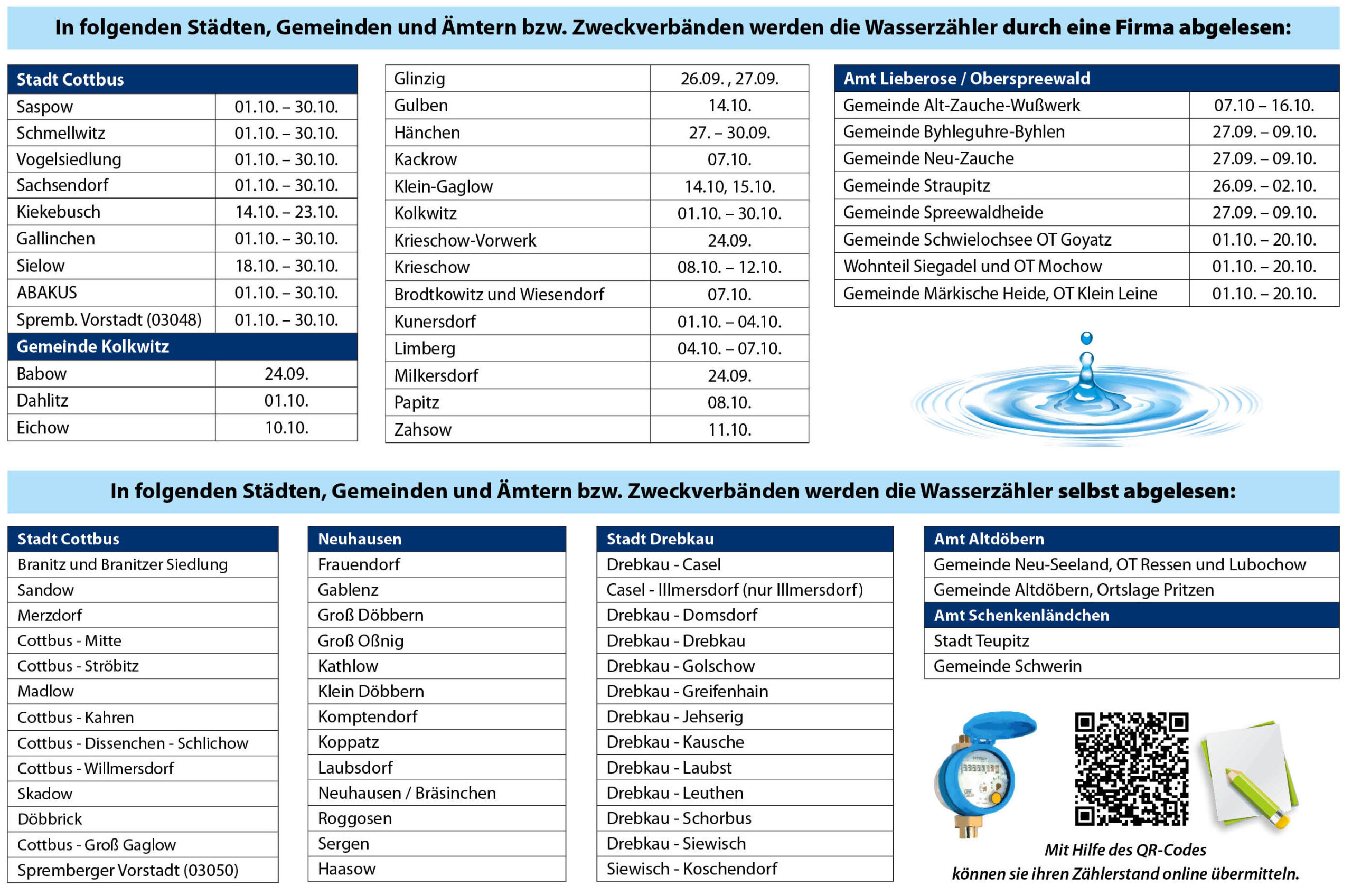Wassermanagement – eine Aufgabe für alle!
Herausgeber: LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG • Ausgabe Cottbus

Drei der acht Partner im „Wasserverbund Niederlausitz“ sind Mitherausgeber der WASSERZEITUNG: die LWG Cottbus, der GWAZ Guben und der WAC Calau. Das Bild entstand während der Unterzeichnung des Gründungsvertrages Ende April. Weitere Partner sind herzlich willkommen!
Foto: zweihelden
Wassermanagement – eine Aufgabe für alle!
Mithilfe von mehreren neu gegründeten kommunalen Gemeinschaften packt die märkische Siedlungswasserwirtschaft die Herausforderungen rund um das Lebensmittel Nr. 1. an. Auf lange Sicht soll unsere existenzielle Ressource Trinkwasser gesichert werden – auch als Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung, etwa den Strukturwandel der Lausitz. Und auch die Wirtschaft selbst kann einiges beim Trinkwassermanagement tun, um den Gebrauch auf einem absolut notwendigen Niveau zu halten.
Ohne Frage leben wir in einer Zeit, in der Wasser immer mehr zum zentralen Thema wird. Sei es wegen der klimatischen Einflüsse oder – wie im Fall der Lausitz – des strukturellen Wandels der regionalen Wirtschaft: Ein smarter und vorausschauender Umgang mit unserer lebenswichtigen Ressource ist unabdingbar. Kommunale Arbeitsgruppen wie der „Wasserverbund Niederlausitz“ oder der „Trinkwasserverbund Lausitzer Revier“ wollen nichts anderes, als die Art und Weise der heutigen Wasserversorgung zukunftsfähig zu machen. Interkommunale Verbundsysteme entstehen, die flexibel auf die Bedürfnisse von Industrie und Gewerbe, Tourismus und Bevölkerung reagieren können.
Die Kraft der Kooperation
Weil unser Wasserkreislauf keine Verwaltungsgrenzen kennt, ist es nur folgerichtig, dass auch die traditionelle Wasserwirtschaft aus ihren Begrenzungen herauswächst. Wie WAL-Verbandsvorsteher Christoph Maschek im neuen Podcast der WASSERZEITUNG (deezer, spotify) erläutert, werden Gemeinschaften gebildet, „ … um den Investoren und der Bevölkerung das Signal zu senden: Die Wasserversorgung ist sicher. Ich kann alle Beteiligten nur ermuntern, dort voranzugehen, um die regionalen Investitionsschwerpunkte wasserseitig zu unterstützen.“
Mit dem mehrfach unter Beweis gestellten Willen zur Innovation und der Kraft der Kooperation lädt die Siedlungswasserwirtschaft insbesondere alle Wasser-Großabnehmer ein, auch selbst Impulse für ein verantwortungsvolles Wassermanagement zu setzen.
Die gratis Himmels-Lieferung
Neben dem Trinkwasser aus der Leitung ist dabei insbesondere ein Augenmerk auf das himmlische Wassergeschenk ratsam: Niederschlag. „Das wird in den Konzepten potenzieller Ansiedler berücksichtigt“, berichtet Christoph Maschek aus dem Lausitzer Revier. „Um zum Beispiel die Löschwasserversorgung vorzuhalten, hat man ja auch Zisternen zu bauen. Damit kann man sehr effizient das Regenwasser auffangen und zwischenspeichern.“ In den gesetzlichen Grenzen, in denen man das dürfe, würde man die lokale Wirtschaft auch zu diesen Themen beraten.
Und selbst das Wasser, das mangels eines unterirdischen Speicherplatzes nicht aufgefangen wird, könnte noch Nutzen bringen. Gerade bei zunehmenden Starkregenereignissen gerät das Volumen selbst üppigster Zisternen schnell an seine Grenzen. Eine denkbare Lösung: Dachbegrünung!
Vorteile von Regenwasser
„Gründächer funktionieren sehr wohl auch im Zusammenhang mit installierten Photovoltaikanlagen“, wirbt Karsten Horn, Projektleiter Strukturwandel bei der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG in Cottbus, für das Ausschöpfen aller Möglichkeiten. „Da gibt es je nach Statik verschiedene Optionen, mit mehr oder weniger Pflegebedarf. Der angenehme Nebeneffekt in heißen Sommern ist eine gute Klimatisierung und dass die Hitze nicht ins Gebäude durchschlägt.“
Die Verwendungsmöglichkeiten von Niederschlag gehen jedoch weit darüber hinaus. Für viele industrielle Prozesse ist das „weiche“ Regenwasser sogar ausgesprochen vorteilhaft – nach minimaler Aufbereitung beziehungsweise Filterung. Und wer besonders innovativ sein will, nutzt es als Grauwasser für die Toilettenspülung.
„Das große Thema hinter all dem ist für mich, wo die genutzte Ressource Wasser herkommt“, fasst Karsten Horn zusammen. „Brauchwasser in der Industrie kommt über Brunnen genauso aus dem Grundwasser wie unser Trinkwasser. Da gibt es also eine gewisse Konkurrenzsituation.“ Eine Entspannung sei möglich, wenn zum Beispiel Wasser, das ausschließlich zur Kühlung verwendet werde, in Kreisläufen verbleibt und wiederverwendet wird. Dies betrifft immerhin rund die Hälfte aller wassergestützten Prozesse in der Industrie.
Reden wir über Ihr Wasser!
„Und wenn man noch einen weiteren Mehrwert generieren will, zieht man sogar noch die Energie aus dem Wasser. Das könnte die Gasverbräuche fürs Heizen drücken.“ Die nötige Technik sei längst „state-of-the-art“, was fehle seien verpflichtende Vorgaben vonseiten des Gesetzgebers. Karsten Horn: „Weil Investitionen in nachhaltige Wassernutzung natürlich etwas teurer sind, sollte sich die Politik Gedanken über geeignete Förderinstrumente machen. Gerade in Bereichen wie der Lausitz sollte es einen Ausgleich für denjenigen geben, der selbst freiwillige Vorgaben des Wassermanagements erfüllt. Es dürfe keine Konkurrenz zu anderen Standorten geben. Und grundsätzlich gilt der Rat des Cottbuser Fachmanns an Unternehmen, ihre Ver- und Entsorgungskonzepte mit den ortsansässigen Wasserbetrieben abzustimmen.
Was bedeutet Wassermanagement für Unternehmen?
- Speicherung und Nutzung von Niederschlagswasser
- Nutzung von Abwasser als Energiequelle
- Einsatz von wassersparenden Armaturen
- Kreislaufführung in wasserintensiven Betrieben (Kühlung)
- Dezentrale Vorbehandlung von spezifisch verschmutzten Abwässern